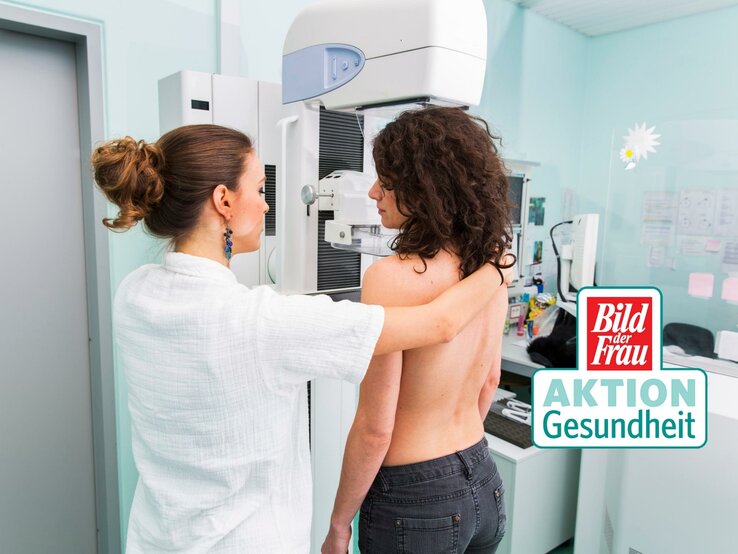Krank, aber niemand hört hin: So sehr werden Frauen im Gesundheitssystem benachteiligt

"Die Medizin wurde von Männern für Männer gemacht": Laut einer Studie werden Frauen werden zu oft nicht ernst genommen, falsch behandelt oder jahrelang ohne Diagnose gelassen. Was eine Gynäkologin über diesen Missstand sagt.
Neue Erkenntnisse, die uns zu denken geben sollten: Fast jede dritte Frau in Deutschland hat schon erlebt, dass sie beim Arzt, aber auch bei einer Ärztin wegen ihres Geschlechts nicht ernst genommen wurde – dreimal so viele wie Männer. Gerade junge Frauen meiden regelrecht den Gang in eine Praxis, aus Angst, abgewiegelt oder falsch behandelt zu werden.
Schmerzen, die als "psychosomatisch" abgetan werden, Fehldiagnosen bei Herzinfarkten, jahrelanges Warten auf die richtige Therapie bei Endometriose: Eine aktuelle YouGov-Umfrage im Auftrag des Healthtech-Unternehmens Doctolib zeigt, wie tief das Problem sitzt – und wie systematisch Frauen in der Medizin benachteiligt werden. Gynäkologin Prof. Dr. Mandy Mangler, Chefärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum und dem Vivantes Klinikum Neukölln in Berlin, spricht im Interview über veraltete Strukturen, fehlende Forschung – und warum es höchste Zeit ist, die Medizin geschlechtersensibel neu zu denken.
Wie das Gesundheitssystem Patientinnen im Stich lässt – ein Interview mit Prof. Dr. Mandy Mangler
BILD der FRAU: Liebe Frau Mangler, fast jede dritte Frau hat sich schon mal im Gesundheitssystem benachteiligt gefühlt: Das sind ganz schön viele. Zu viele. Wie erleben Sie das?

Es ist nachvollziehbar – und wir wissen aus Studien, dass Frauen bei Schmerzen länger in der Notaufnahme warten, weniger Schmerzmittel erhalten und weil ihre Symptome oft nicht erkannt werden, prozentual häufiger an Herzinfarkten sterben.
Deshalb ist es gut, dass wir das Thema benennen und die Strukturen für Frauen verbessern. Medical Gaslighting, also das Herabwürdigen von Symptomen, das Nicht-ernst-Nehmen oder das Schieben auf psychische Ursachen, betrifft zu einem großen Teil mehr Frauen als Männer. Wir nehmen Frauen viel weniger ernst als Männer.
Was läuft Ihrer Meinung nach grundsätzlich schief, wenn so viele Frauen das Gefühl haben, nicht ernst genommen zu werden – selbst wenn sie mit Schmerzen eine Praxis aufsuchen?
Die Medizin wurde von Männern für Männer gebildet. Wir haben eine am männlichen Standardpatienten ausgerichtete Medizin. Das ist direkt von Nachteil für alle, die diesem Mainstream nicht entsprechen, also für Frauen, aber auch für einen großen Teil der Männer selbst.
In Berlin durften Frauen beispielsweise noch bis 1910 nicht Medizin studieren. Sie sind unterrepräsentiert in Führungspositionen: Nur 14 Prozent der Führungspositionen in der deutschen Universitätsmedizin sind mit Frauen besetzt. Damit können weibliche Perspektiven, Ideen und Forschungsfelder weniger gut durchgesetzt werden.
Besonders häufig berichten Frauen, dass ihre Beschwerden als "psychosomatisch" abgetan wurden. Was meinen Sie, warum passiert das so oft – gerade bei Frauen?
Der Begriff "Hysterie" leitet sich vom griechischen Wort "Hystera" für Gebärmutter ab. Da wir in der Medizin von einem männlichen Standardpatienten ausgehen, verstehen wir die Symptome von Frauen weniger gut und können sie weniger gut deuten. Dann denken wir schnell, dass wir als Ärztinnen und Ärzte im Gesundheitswesen ja nicht das Problem sein können, sondern dass das Problem bei der Patientin liegt.
Das hat auch viel mit Hybris und unserem Verständnis von Frauen an sich zu tun. Wir leben nicht gerade in einer frauenfreundlichen Welt. Studien zeigen beispielsweise, dass hoch qualifizierte Frauen zu knapp 70 Prozent negatives Feedback bekommen, während es bei Männern in gleicher Position nur 4 Prozent sind. Wie es zu dieser Schieflage gekommen ist, ist merkwürdig und hat sich über lange Zeit verfestigt.
"Das ist nur die Psyche" – Frauen werden nicht ernst genommen
Wie erkennt man als Ärztin den Unterschied zwischen einer echten psychosomatischen Komponente – und der Gefahr, eine ernsthafte körperliche Ursache zu übersehen?
Man sollte alle Symptome immer ernst nehmen, bei Frauen sogar noch mehr. Bevor man sagt: "Das ist psychosomatisch", sollte man sich ganz sicher sein und lieber noch einmal extra abklären lassen. Es gibt so viele Frauen, bei denen Herzinfarkte und chronische Erkrankungen nicht erkannt wurden und denen gesagt wurde: "Das ist alles nur Ihre Psyche."
Viele Frauen sagen: Ich gehe lieber nicht zum Arzt, weil ich Angst habe, nicht ernst genommen zu werden. Wie kann man dieses Vertrauen zurückgewinnen?
Wir sollten im Dialog bleiben und uns regelmäßig gegenseitig Feedback geben. Wenn wir eine Vermeidungsstrategie fahren, lernen wir nichts. Wachsen können wir nur, wenn wir uns das Problem eingestehen und uns an die Lösung machen.
Als Patientin handhabe ich das aber so, dass ich mir genau ansehe, wer mich ernst nimmt, wer es schafft, meine Perspektive als Frau und auf meinen weiblichen Körper einzunehmen, und wer nicht. Ich gehe explizit zu Menschen, die das hinbekommen.
Wenn wir über typische Frauenkrankheiten wie Endometriose oder PCOS sprechen – warum werden diese oft spät erkannt oder falsch behandelt?
Diese Frauenerkrankungen sind untererforscht. Es gibt eine Statistik, die zeigt, dass mehr Gelder in Studien zur männlichen Erektion fließen als in Frauenthemen. Die Frauenforschung ist unterfinanziert.
Viele Betroffene müssen mehrere Ärztinnen oder Ärzte aufsuchen, bis sie eine Diagnose bekommen. Was erleben Sie da in Ihrer Praxis?
Ja, auch das erlebe ich oft: Frauen in den Wechseljahren beispielsweise gehen wegen Gelenkschmerzen zum Orthopäden, wegen psychischer Veränderungen zur Psychiaterin und wegen Blutungsstörungen zu mir. Ich finde es interessant, dass diese Fäden nicht zusammengeführt werden. All das sind Symptome der Wechseljahre. In Deutschland dauert es im Mittel neun Jahre, bis bei Frauen mit Endometriose die Diagnose gestellt wird.
Standardtherapien ohne individuelle Anpassungen
Wird geschlechterspezifische Medizin heute überhaupt ausreichend in der Ausbildung behandelt – oder ist die Standardmedizin noch immer eher auf Männer ausgerichtet? Gerade im Hinblick auf einen Herzinfarkt wäre das ja eigentlich fahrlässig…
Leider noch nicht. Im Prinzip müssten alle Fachrichtungen aus Genderperspektive betrachtet werden. Erst eine individualisierte Medizin ist eine gute Medizin. Wir sollten wegkommen von einem Gießkannenprinzip, bei dem alle eine Standardtherapie erhalten. Eine Therapie sollte an den individuellen Körper und die Bedürfnisse angepasst sein.
Was würden Sie sich konkret von Kolleginnen und Kollegen in anderen Fachrichtungen wünschen – z. B. Hausärztinnen und -ärzte oder Notaufnahmen – damit Beschwerden von Frauen besser erkannt werden?
Wir müssen Frauen ernst nehmen und uns bei weiblichen Patientinnen mehr Mühe geben, bis wir diese Ungerechtigkeit der ganzen Gaps ausgeglichen haben. Bisher haben wir den Gender Pain Gap, den Gender Research Gap, den Gender Health Gap usw.
Lesetipp: Alltagssexismus passiert auch – oft ganz beiläufig – beim Reden. Wie Sprache unbemerkt diskriminiert, erklärt eine Linguistin.
Wenn Sie auf die letzten Jahre schauen: Hat sich auch etwas gebessert in der Versorgung von Frauen – oder wird die Situation wirklich überall schwieriger?
Es ist eine Verbesserung, dass wir das jetzt wissen und klar benennen können. Wir haben in Studien bewiesen, dass Frauen in der Medizin benachteiligt werden. Vor zehn Jahren hatten wir noch das Gefühl, dass es so ist, uns fehlte aber die Evidenz. Jetzt, wo wir es klar bewiesen haben, können wir uns der Lösung widmen.
Und ganz persönlich gefragt: Was gibt Ihnen Hoffnung, dass sich das Gesundheitssystem für Frauen wirklich verbessert?
Es gibt mir Hoffnung, dass Frauen heute Strukturen mitbestimmen und in Führungspositionen vertreten sind. Manchmal wird meine Hoffnung gedämpft, beispielsweise durch eine aktuelle Studie von Tauber et al. (2025), in der festgestellt wurde, dass sich nur 3,6 Prozent der jungen Ärztinnen vorstellen können, Chefärztin zu werden, während es bei den jungen Ärzten 29 Prozent sind. Das ist schade, und wir sollten täglich daran arbeiten, dass sich das ändert.
Hoffnung macht mir, dass 75 Prozent der im Gesundheitswesen Beschäftigten Frauen sind, dass sie sich heute viel mehr unterstützen als früher und dass Netzwerken heute selbstverständlich ist. Wir empfehlen uns gegenseitig, wir schätzen einander und wir fördern uns. Das ist wichtig, denn die patriarchale Struktur hatte ihre Chance und hat uns Frauen benachteiligt – wir müssen uns selbst darum kümmern. An unserer Seite stehen auch kluge und starke Männer, die keine Angst vor starken Frauen haben. Das ist gut so.
Weitere Artikel über Frauenmedizin liest du hier:
- Für Ärzte ist der Standardpatient ein Mann. An seinem Körper und anhand seiner Symptome haben sie Medizin gelernt. Das ist ein Problem für Frauen.
- Deutschlands führende Expertin für Endometriose sagt, was Betroffene wissen sollten – und was sich ändern muss.
- Broken Heart-Syndrom: Ein Herzchirurg hat den Unterschied von Männer- und Frauenherzen im Blick.
- Betroffene Frauen wissen oft zu wenig über die Wechseljahre – aber auch Ärztinnen und Ärzte kennen sich nicht immer aus.